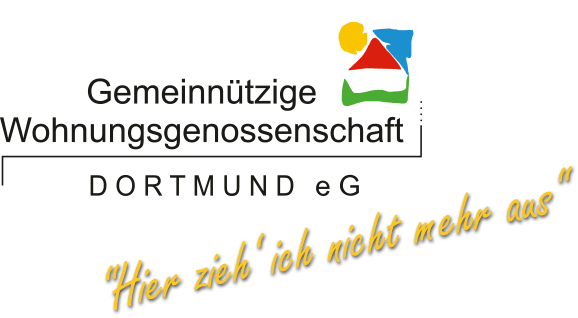Am 8. Juni 2016 fand die diesjährige Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2015 statt. Der Aufsichtsratsvorsitzender Joachim Pohlmann hatte hierzu wieder in das Gemeindehaus der Franziskanergemeinde geladen. Auch in diesem Jahr konnte die Genossenschaft im Rahmen der Mitgliederversammlung wieder 16 Mitglieder für Ihre mehr als 50jährige Mitgliedschaft ehren. Für ihre langjährige Treue bedankte sich der Vorstand mit einer Urkunde, einem Blumenstrauß und einer Flasche Wein bei den Jubilaren.

Hans-Dieter Derenthal, Thomas Bura und Rudolf Schmidt,
(v.l.) vom Vorstand mit der Ehrung von Horst Lembeck (2 v.l.),
der seit September 1964 Mitglied der Genossenschaft ist
Der Vorstandsvorsitzende Thomas Bura berichtete im weiteren Verlauf von einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2015. Der Jahresüberschuss lag mit rund 613 T€ etwa auf dem Niveau des Vorjahres, sodass der Vorstand seinen Mitgliedern auch in diesem Jahr eine Dividende von 4 % je Geschäftsanteil zur Ausschüttung vorschlagen konnte.
Bei der Neuvermietung war für das Kalenderjahr 2015 ein deutlicher Anstieg festzustellen. Hier gab es im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von knapp 23 %.
Die Erhaltung und Pflege des Althausbestandes blieb auch im Kalenderjahr 2015 weiterhin der Schwerpunkt der Genossenschaft . Mit 4.201.000,00 € lagen die Gesamtinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 % höher.
Für das Neubauprojekt in Dortmund-Asseln konnte Herr Bura noch keinen Baubeginn vermelden. Obwohl der Bauantrag bereits Mitte Dezember 2015 bei der Stadt Dortmund eingereicht wurde, steht die Baugenehmigung weiterhin aus. Der Vorstand stehe aber im regelmäßigen Kontakt mit der Stadt und erwartet den Baubeginn im zweiten Halbjahr 2016.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Joachim Pohlmann (l.)
und der Vorstandsvorsitzende Thomas Bura erläutern
die Situation um das Neubauprojekt in Dortmund-Asseln
Turnusgemäß stand die Neuwahl von insgesamt 3 Aufsichtsratsmitgliedern auf dem Programm. Hier wurden Frau Cornelia Wegener, Herr Michael Fanto und Frau Anna-Maria Müller einstimmig in den Aufsichtsrat wiedergewählt.